Nach längerer Krankheit starb am 7. Februar 1957 Prälat Dr. Petro Werhun. Der Apostolische Visitator für die ukrainischen Katholiken in Deutschland verschied im fernen Sibirien, im Krasnojarsker Gebiet, in der Ansiedlung Angora, wo der gleichnamige Fluss in den Jenissei mündet. Als standhafter Bekenner des Glaubens wurde er ein Opfer des bolschewistischen Terrors und gab sein Leben für Christus und seine heilige Kirche. Im Jahr 2001 sprach Papst Johannes Paul II. Petro Werhun selig.
Lebenslauf
Frühe Jahre und priesterliche Berufung
Petro Werhun wurde 1890 in Horodok bei Lwiw (Lemberg) als österreichischer Staatsbürger geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er erfolgreich das ukrainische Gymnasium sowie die Lehrerbildungsanstalt. Während des Ersten Weltkriegs stand er im Militärdienst, wo er auch verwundet wurde. Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie trat er der Ukrainisch-Galizischen Armee bei, um für die Freiheit seiner Heimat zu kämpfen.
1920 geriet Werhun in polnische Gefangenschaft. Ihm gelang jedoch die Flucht nach Deutschland. Dort reifte der Entschluss in ihm, Priester zu werden. Er studierte an der Karls-Universität in Prag osteuropäische Kirchengeschichte, Ukrainistik, Kunstgeschichte und Theologie. An der damals in Prag ansässigen Ukrainischen Freien Universität promovierte er am 15. Oktober 1926 zum Doktor der Philosophie.
Am 30. Oktober 1927 empfing Petro Werhun durch Metropolit Andrej Scheptyzkyj in Lwiw die Priesterweihe. Bereits im folgenden Monat wurde er vom Metropoliten nach Berlin entsandt, um die ukrainischen Gläubigen in Deutschland seelsorglich zu betreuen.
Seelsorge in Deutschland
In den ersten Jahren galt sein pastoraler Einsatz vor allem den verstreuten Arbeitskolonien und landwirtschaftlichen Saisonarbeitern. Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft, insbesondere ab 1939, wuchs die Zahl der nach Deutschland angeworbenen oder verschleppten Ukrainerinnen und Ukrainer auf etwa 1,5 Millionen an.
Trotz begrenzter personeller Ressourcen bewältigte Petro Werhun, der 1937 zum päpstlichen Hausprälaten ernannt worden war, unermüdlich die steigenden seelsorglichen Anforderungen. Er reiste von Ort zu Ort und stand unter ständiger Beobachtung der Gestapo, die ihn 1939 bereits ausweisen wollte – ein Vorhaben, das nur durch das Eingreifen des päpstlichen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Cesare Orsenigo (1873–1946), abgewendet werden konnte.
Am 23. November 1940 errichtete Papst Pius XII. die Apostolische Administratur für die katholischen Ukrainer in Deutschland und ernannte Werhun zum Apostolischen Visitator mit den Rechten eines Administrators. Unter seiner Leitung entstand eine organisierte Struktur der ukrainischen Seelsorge in Deutschland: Mehrere Pfarreien wurden gegründet und Schulen in Bremen und Hamburg eingerichtet. Etwa zehn Priester unterstützten ihn in seinem Wirken. Seine Mitbrüder erlebten ihn als Freund und Vater, der Konflikte im Geist der Nächstenliebe und Gerechtigkeit löste. Sein seelsorgliches Anliegen drückte er in einem Brief vom 8. Juni 1941 so aus:
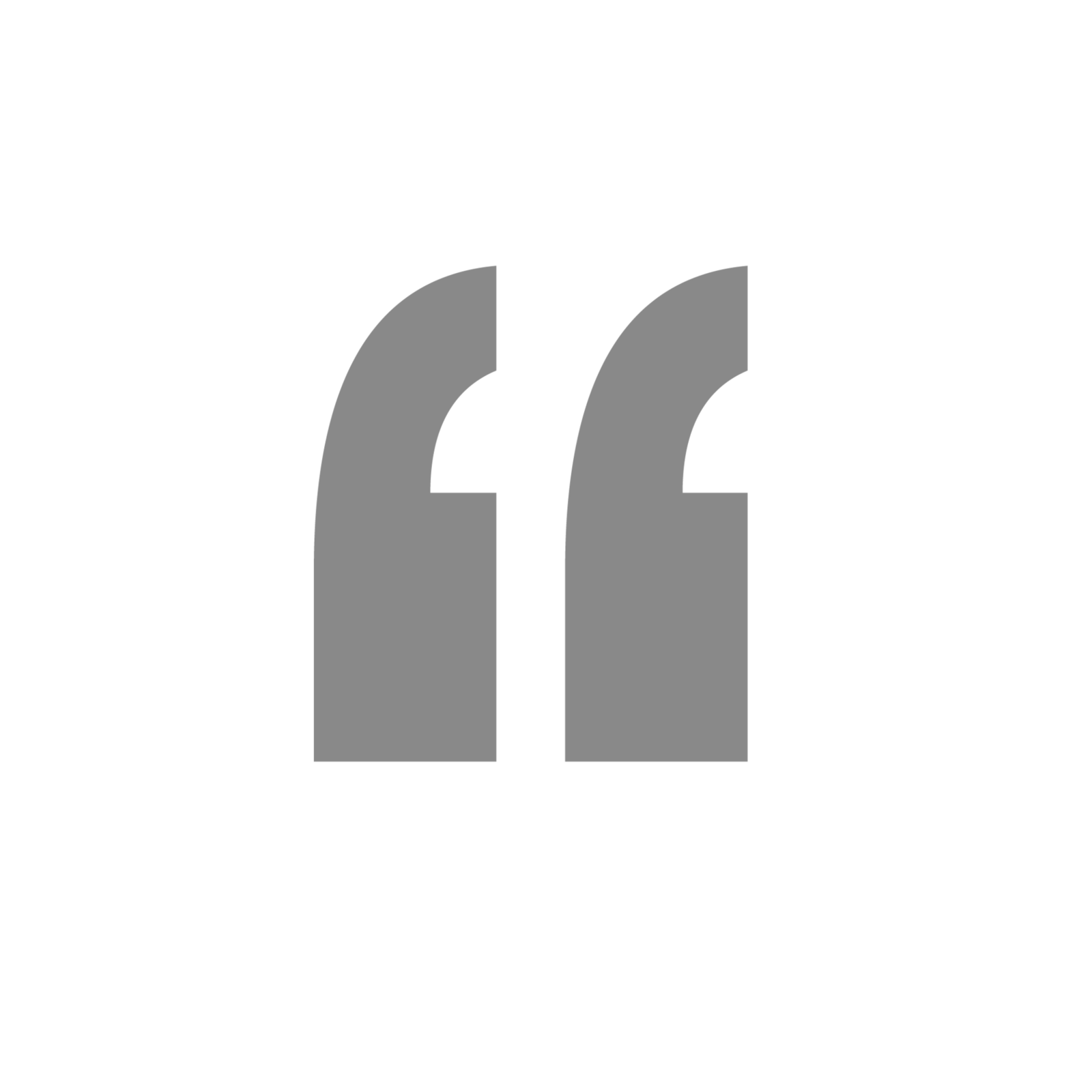
- Ich bin besorgt um Eure priesterliche Heiligung. Nur jener, der aus der Fülle des geistlichen Lebens schöpft, kann dieses Leben in die Herzen und Seelen seiner Gläubigen einpflanzen. Bitte sorgt dafür, vor allem erfüllt zu sein vom Geist Gottes und der Göttlichen Liebe.
Besondere Verehrung brachte Werhun der Gottesmutter Maria entgegen. 1943, am Fest Maria Schutz, vertraute er alle ukrainischen Pfarreien und Missionsstationen ihrem Schutz an. In einem Hirtenbrief schrieb er:
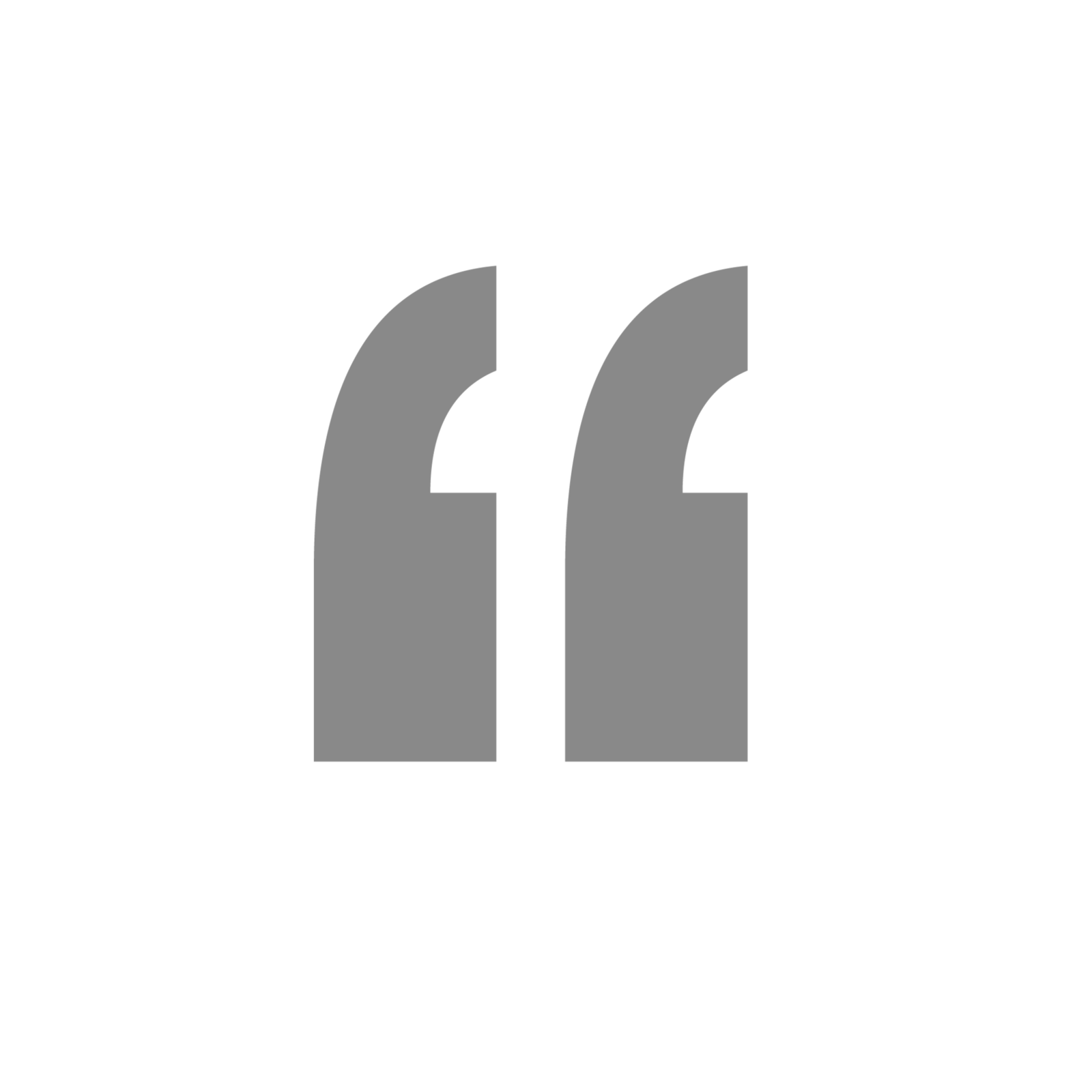
- Bittet immer um Hilfe und die Gottesmutter wird euch vor allem Bösen bewahren. Dann werden unsere täglichen Sorgen leichter, die Sirenen nicht erschreckend und der Tod wird nicht mehr zu fürchten sein, denn die Gottesmutter und der Erlöser selbst werden bei uns sein.
Petro Werhun beschränkte sich aber nicht auf die unmittelbare Betreuung seiner Landsleute, sondern förderte auch den Dialog zwischen Ost und West. In zahlreichen Kirchen und Priesterseminaren in Deutschland organisierte er Ostkirchentage. Besonders bedeutsam war seine Zusammenarbeit mit dem Älterenbund von „Neudeutschland“, dem Verband der katholischen Jugendbewegung: Fahrtengruppen reisten nach Jugoslawien und Rumänien, um die dortigen deutschen Volkszugehörigen religiös und kulturell zu unterstützen und die ostkirchliche Tradition besser kennenzulernen. Daraus gingen sogenannte „Ostkirchenkreise“ hervor, die Werhun zu Vorträgen und zur Feier der Liturgie einluden.
Verfolgung und Martyrium
Nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes 1945 entschied sich Petro Werhun trotz aller Gefahren in Berlin zu bleiben, um seinen rund 5.000 Landsleuten weiterhin beistehen zu können. Ursprünglich hatte er geplant, sich in die Benediktinerabtei Niederaltaich zurückzuziehen, wo er seit 1938 als Oblate aufgenommen war. Stattdessen wurde er am 22. Juni 1945 von sowjetischen Einheiten verhaftet. Wenige Tage später durfte er unter Bewachung seine Wohnung ein letztes Mal betreten, um einen Mantel, eine Schlafdecke und etwas Wäsche mitzunehmen. Danach verlor sich seine Spur.
Jahre später wurde bekannt, dass ein sowjetisches Militärtribunal ihn wegen angeblicher „Kollaboration“ zu acht Jahren Zwangsarbeit verurteilt hatte. Nach der Haft im Straflager Tajschat am Baikalsee wurde er nach Ostsibirien verbannt. Entlassen aus dem sibirischen Arbeitslager wurde er erst im Jahr 1955 – zwei Jahre nach Ablauf der ursprünglich auf acht Jahre festgelegten Haftzeit. Trotzdem durfte Petro Werhun den Ort seines Exils in der Siedlung Angarsk nicht verlassen: Er durfte weder in seine Heimat Galizien zurückkehren noch – trotz seiner deutschen Staatsbürgerschaft – nach Deutschland ausreisen.
In gesundheitlich zunehmend geschwächtem Zustand verbrachte Petro Werhun seine letzten Lebensjahre in der Verbannung. Er selbst berichtete von Problemen mit Herz und Magen und äußerte die Hoffnung, ein Klimawechsel könnte Linderung bringen – ein Wunsch, der sich nicht mehr erfüllte. In einem Brief äußerte er seine Sehnsucht, seinen Lebensabend in einem Kloster zu verbringen:

- Ich spüre, dass sich mein Haupt bereits zur ewigen Ruhe neigt. Ich möchte mein Leben sehr gerne in einem Kloster beschließen.
Auch dieser Wunsch konnte sich nicht mehr erfüllen: Am 7. Februar 1957 verstarb Petro Werhun in Angarsk und wurde in der gefrorenen Erde Sibiriens begraben.
Seligsprechung und Verehrung
Am 27. Juni 2001, während seines Pastoralbesuchs in der Ukraine, sprach Papst Johannes Paul II. Petro Werhun zusammen mit 26 weiteren Märtyrern selig. Sie alle hatten ihr Leben während der nationalsozialistischen oder kommunistischen Verfolgung wegen ihres Glaubens verloren.
Ein Jahr später wurde sein Grab in Angarsk, Sibirien, gefunden und seine Gebeine erhoben. In den darauffolgenden Jahren kehrten seine Reliquien sowohl in seine ukrainisch-galizische Heimat als auch an seine Wirkungsstätte Deutschland zurück: Im Mai 2006 überreichte Seine Seligkeit Ljubomyr Kardinal Husar während seines Besuchs in Deutschland Reliquien des Seligen an das Erzbistum Berlin und an die Benediktinerabtei Niederaltaich.
Auch in der Kathedrale Maria Schutz und St. Andreas der Apostolischen Exarchie in München werden Reliquien von Petro Werhun aufbewahrt – als Zeichen seiner bleibenden geistlichen Nähe zu den Menschen, für die er sein Leben hingab.
